Vor dem Hintergrund ausufernder Staatsverschuldungen in nahezu allen Ländern Europas sowie den ungebremsten Ankaufprogrammen für europäische Staatsanleihen seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) ist die Befürchtung groß, dass die damit verbundene Steigerung der Geldmenge bzw. „Flutung“ der Märkte mit Liquidität zwangsläufig zu einer massiven Inflationierung führen muss. Manchmal wird sogar die Vermutung geäußert, dass eine Inflation vielleicht sogar absichtlich herbeigeführt werden könnte, um es den hochverschuldeten Staaten zu ermöglichen, ihre Schulden auf diese Weise loszuwerden1. Nicht wenige befürchten darüber hinaus sogar den Zusammenbruch des gesamten Euro-Währungssystems.
Gewollt oder ungewollt schließt man sich mit solchen Befürchtungen der Lehre des durchaus umstrittenen Ökonomen Milton Friedman an, für den Inflation stets und ausschließlich ein monetäres Phänomen war, was dann auch zu seiner Quantitätstheorie des Geldes geführt hat. Gemeinsam mit Anna Schwartz hat er in bahnbrechenden empirischen Arbeiten einen engen Zusammenhang zwischen der Zunahme der Geldmenge und der Inflationsrate festgestellt, sprich je größer die Geldmenge im Umlauf, desto höher ist tendenziell die Inflation, wie in der folgenden Grafik dargestellt.

Die große Frage ist daher, ob dieser Zusammenhang auch heute noch gilt und ob man daher – insbesondere aufgrund der im Zuge der Coronakrise noch weiter anwachsenden Geldmenge – in den nächsten Jahren mit einer kräftigen, wenn nicht sogar unkontrollierbaren Entwertung des Euros rechnen muss? Um diese Frage zu beantworten, ist es zunächst erforderlich, zwischen relativen und absoluten Preissteigerungen zu unterscheiden.
Abgrenzung von relativer zu absoluter Preissteigerung
Relative Preissteigerungen bedeuten lediglich, dass eine bestimmte Ware oder Dienstleistung relativ zu einer anderen teurer wird. Dies muss nicht mit einem Anstieg des allgemeinen Preisniveaus verbunden sein. Wahrscheinlich erleben wir in den nächsten Monaten hierzu sogar ein gutes Beispiel: Aufgrund der Corona-bedingten Abstandsregeln können Restaurants nach ihrer Wiedereröffnung nur ca. die Hälfte ihrer eigentlichen Kapazitäten nutzen. Die dadurch bewirkte Angebotsverknappung wird vermutlich zu einer entsprechenden Teuerung führen. Sicher ist dies allerdings nicht, denn es kann durchaus sein, dass wir einen noch stärkeren Rückgang der Nachfrage aus Angst vor einer Ansteckung mit COVID-19 sehen werden. In diesem Fall hätten wir es trotz geringerer Restaurantkapazitäten sogar mit einem Überangebot zu tun und könnten mit entsprechenden Preissenkungen rechnen. Sollten die Preise für Restaurantbesuche allerdings tatsächlich steigen, alle anderen Preise für Waren und Dienstleistungen aber im Wesentlichen gleich bleiben (oder gar sinken), so hätten wir es eben lediglich mit einer relativen Preissteigerung zu tun – nämlich derjenigen von Restaurantbesuchen im Vergleich zu allen anderen.
Verschiebungen der relativen Preise sind in einer Volkswirtschaft ein völlig normaler Vorgang. Sie sind definitiv nicht gemeint, wenn von allgemeinen Preissteigerungen, sprich von Inflation, die Rede ist. Mit dem Begriff Inflation ist immer die Zunahme des allgemeinen Preisniveaus, d. h. die Zunahme mehr oder weniger aller Preise verbunden. Doch auch hier muss unterschieden werden, ob diese absoluten Preissteigerungen (Inflation) konjunkturell bedingt sind oder Ausdruck eines Vertrauensverlustes in die staatlichen Institutionen, insbesondere in das System europäischer Zentralbanken.
Konjunkturell bedingte Inflation
Konjunkturell bedingte Veränderungen des allgemeinen Preisniveaus entstehen durch ein Missverhältnis zwischen der sogenannten aggregierten Gesamtnachfrage einer Volkswirtschaft (Konsum, Investitionen, Staatsverbrauch und Exporte) und dem aggregierten Angebot (Bruttoinlandsprodukt und Importe). Übersteigt die Nachfrage das Angebot, dann wirkt dies tendenziell preistreibend (inflationär). Übersteigt dagegen das Angebot die Nachfrage, so wirkt dies preisdämpfend (deflationär). Seit Einführung der europäischen Gemeinschaftswährung zur Jahrtausendwende ist es der EZB gelungen, die Inflation in Europa auf einem angestrebten Niveau von ca. 2 % oder darunter zu halten.

Ob nun aufgrund der aktuellen Krise eher inflationäre oder deflationäre Tendenzen zu erwarten sind, ist eine noch offene Frage. Denn im Gegensatz zu einem „normalen“ konjunkturellen Abschwung – in dem üblicherweise die Nachfrage schwächelt – haben wir es aktuell zugleich mit einem Angebots- und einem Nachfrageschock zu tun: Der Shutdown hat sowohl die Gesamtnachfrage als auch das Gesamtangebot nach unten gedrückt. Welcher Effekt nun überwiegen wird, bleibt abzuwarten. Es ist daher keineswegs ausgemacht, dass die aktuelle Krise zu einer Inflation führen muss, von der viele Analysten ausgehen. Genauso plausibel ist ein konjunkturelles Deflationsszenario (reduzierte Nachfrage, Überangebot, sinkende Preise). Doch selbst wenn es zu einem Nachfrageüberhang kommen sollte, mit dem Ergebnis einer zunehmenden Inflation, dann wäre dies ein absolut normaler Vorgang ohne massiv steigende Inflationsraten und hat mit den eingangs erwähnten Befürchtungen oder gar mit einem Zusammenbruch des Euro-Währungssystems nichts zu tun.
Damit sind wir bei dem zweiten und durchaus gefährlichen Szenario allgemeiner Preissteigerungen angelangt: die Erosion des Vertrauens in die Integrität nationalstaatlicher und europäischer Institutionen, insbesondere der EZB.
Inflation aufgrund des Verlustes an Vertrauen
Ein um sich greifender Vertrauensverlust in staatliche Institutionen ist die markanteste und zugleich die am wenigsten greifbare Inflationsursache. Um nun zu entscheiden, ob diese Art der Inflation in der aktuellen Situation mit starker Geldmengenausweitung tatsächlich eine reale Gefahr darstellt, ist es ganz hilfreich, sich den Mechanismus einmal etwas genauer anzuschauen, der mit einem solchen Vertrauensverlust verbunden ist.
Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Inflationserwartung. Wenn breite Bevölkerungskreise eine hohe, sich womöglich noch beschleunigende Inflation (Verminderung des Geldwertes) erwarten, verliert Geld eine seiner wichtigsten Funktionen, nämlich als Mittel der Wertaufbewahrung zu dienen. Die Geldhaltung in heimischer Währung und die Nachfrage nach sämtlichen Anlagen, welche Zinsen und Tilgung in dieser Währung zahlen, geht dann dramatisch zurück. Im Extremfall – wenn die Inflationsraten zwei- und dreistellig werden – verliert Geld dann auch seine Funktion als allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel. Die Menschen horten dann sogar die Güter des täglichen Bedarfs und es etabliert sich unter Umständen sogar ein alternatives Tauschmedium, wie z. B. Tabak und Zigaretten. Die eigentliche Währung wird dann nur noch widerwillig und nur aufgrund des staatlichen Zwanges als Zahlungsmittel akzeptiert.
Doch besteht in der aktuellen Situation tatsächlich die beschriebene Gefahr? Unbestritten ist, dass sowohl der Umfang der mittlerweile angehäuften Staatsschulden als auch das Volumen der Zentralbankbilanz (Letztere wird im Zuge der massiven Anleiheaufkäufe aufgebläht) besorgniserregend sind – und beide werden aufgrund der diversen Stabilisierungs- und Hilfsmaßnahmen noch deutlich weiter steigen.


Doch sind diese Entwicklungen tatsächlich ein ausreichender Grund, um eine massive Inflationierung oder gar einen Zusammenbruch der Währung befürchten zu müssen? Wir glauben dies nicht.
So lassen sich beispielsweise aus den relevanten Marktpreisen von sogenannten Inflations-Swaps, die eine nützliche Indikatorfunktion besitzen, keine besondere Inflationsbefürchtungen ablesen.

Zudem ist auch die Nachfrage nach Euro-Anlagen nicht rückläufig. Zwar gibt es innerhalb des Euro-Raumes Nachfrageverlagerungen, nach wie vor aber sind beispielsweise Anleihen der „sicheren Häfen“, wozu Länder wie Deutschland, die Niederlande und Finnland zählen, begehrte Anlageobjekte, was sich unter anderem auch an den nach wie vor negativen deutschen Renditen in so gut wie allen Restlaufzeiten zeigt. Ein Anlageumfeld, in dem die Furcht vor einem Kollaps der Währung dominiert, sieht deutlich anders aus. Es wäre geprägt von extrem hohen Zinsen, denn Anleger wären nur bereit, in eine solch risikoreiche Währung zu investieren, wenn sie zinsseitig hoch entlohnt werden.

Ein ebenso gutes Zeichen dafür, dass das Vertrauen in die Stabilität des Euros nach wie vor intakt ist, sind die Renditedifferenzen zwischen inflationsindexierten2 und „herkömmlichen“ Anleihen, aus denen etwaige Inflationserwartungen der Marktteilnehmer herausgelesen werden können. In den letzten Wochen und Monaten gab es hier ebenfalls keine dramatischen Veränderungen.
Schuldenlast ist tragbar – wenn der Konsolidierungskurs nach der Krise fortgeführt wird
Hyper-Inflationen bis hin zu Währungsreformen waren immer von einem vorgelagerten Vertrauensverlust in die staatlichen Institutionen begleitet. Ein solcher ist momentan weder in Deutschland noch in Europa, noch auf globaler Ebene in Sicht. Im Gegenteil: Von Staaten neben Geldscheinen ebenfalls „bedrucktes Papier“, sprich Staatsanleihen, hat in der aktuellen Krise sogar die Funktion eines Sicherheitsankers übernommen – eine Entwicklung, die also gerade das Gegenteil von Vertrauensverlust widerspiegelt.
Wie bereits betont, ist dies der entscheidende Punkt, denn wie das Geld in allen modernen Volkswirtschaften ist auch der Euro ein sogenanntes „Fiat money“, d. h., er wurde quasi künstlich erschaffen und bezieht seine Werthaltigkeit ausschließlich aus dem Vertrauen in die Institution, die die Währung ausgibt, und natürlich auch aus dem Vertrauen in die Kraft und Leistungsfähigkeit der dahinterstehenden Volkswirtschaften. Und dieses Vertrauen ist nach wie vor intakt, was alle einschlägigen Indikatoren zeigen.
Selbstverständlich gibt es keine Garantie, dass dies immer so bleibt. Wie jedes Vertrauen kann auch das Vertrauen in die Stabilität des Euros aufs Spiel gesetzt werden. Entscheidend dabei wird weniger sein, wie viel zusätzliches Geld aufgrund der Coronakrise in Umlauf gebracht wird und wie viel zusätzliche Schulden die Staaten deshalb machen werden. Wie die meisten Ökonomen sind auch wir davon überzeugt, dass die ergriffenen Maßnahmen aufgrund des besonderen Charakters der Krise vernünftig und sinnvoll waren – auch in ihrem außerordentlichen Umfang.
Der entscheidende Punkt wird nach unserer Überzeugung sein, ob es den Staaten gelingt, die Bürger davon zu überzeugen, dass der Konsolidierungskurs (Reduzierung der Schuldenquote) – der ja bis zum Ausbruch der Krise durchaus erfolgreich eingeschlagen wurde – in den „normalen“ Nach-Corona-Zeiten fortgeführt wird. Ist dies gewährleistet, dann sind auch die derzeitigen und selbst die höheren noch zu erwartenden Schuldenniveaus kein Grund, den Niedergang des Euros zu befürchten. Er wird auch diese Krise überstehen.
.avif)
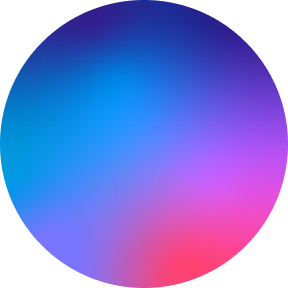






.svg)
.svg)






.svg)
