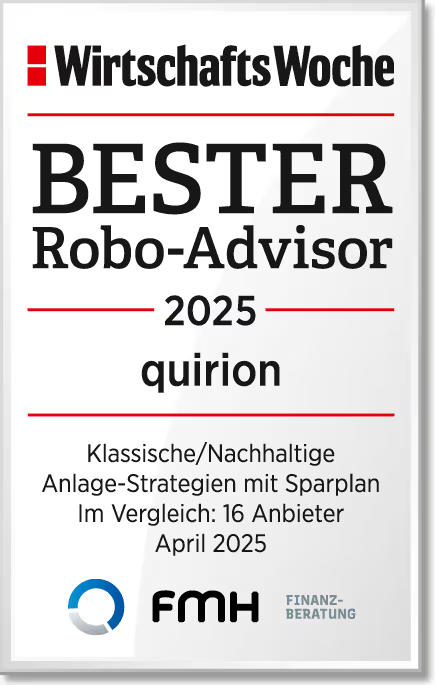Nicht nur am Aktien-, sondern auch am Anleihemarkt hat die Politik von US-Präsident Donald Trump die Kurse belastet. In Medien ist von der Flucht aus US-Staatsanleihen und aus dem Dollar die Rede. Warum Anlegerinnen und Anleger sich davon nicht verunsichern lassen sollten.
Gesetze tragen oft sperrige Namen. Das „Rinderkennzeichnungs- und Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz“ aus Mecklenburg-Vorpommern ist zwar schon länger aufgehoben, führt das aber immer noch besonders plastisch vor Augen.
„Ein großes schönes Gesetz“: Dieser Titel klingt weitaus gefälliger. Auch wenn er keinerlei Hinweis darauf enthält, worum es eigentlich geht. Mit dem „One Big Beautiful Bill Act“ will US-Präsident Donald Trump viele Vorhaben seiner politischen Agenda auf einen Schlag durch den Kongress bringen. Dazu gehören Steuererleichterungen in Höhe von mehreren Billionen US-Dollar. Sparen will Trump dafür unter anderem bei Medicaid, dem US-Programm für Gesundheitsfürsorge. Unter dem Strich stünden jedoch wesentlich geringere Einnahmen höheren Ausgaben gegenüber.
Anleihekurse unter Druck
Das fand vor allem der Anleihemarkt gar nicht „beautiful“. Mit der Vorstellung des Gesetzespakets sanken die Kurse und kletterten die Renditen deutlich. Stoff für Schlagzeilen bot im Mai darüber hinaus eine Auktion 20-jähriger Staatsanleihen. Denn die Nachfrage war relativ schwach und es musste eine Rendite von über fünf Prozent aufgeboten werden, um das geplante Volumen in den Markt zu bringen.
Schon Anfang April waren die Renditen von US-Staatsanleihen stark gestiegen, als US-Präsident Donald Trump die ganze Welt mit extrem hohen Zöllen bedroht hatte. Dass er noch vor deren Inkrafttreten erstmal weitgehend zurückruderte, wurde vor allem auf die Reaktion der Anleihemärkte zurückgeführt. Zwar wünscht sich Trump einen schwächeren Dollar, um US-Exporte attraktiver zu machen. Aber wegen der Schuldenlast der USA möglichst niedrige Zinsen und Anleiherenditen.
„Es zeigt sich, dass der Markt den politischen Handlungsspielraum beschränken kann“, stellt Philipp Dobbert fest, Chefvolkswirt bei quirion und der Quirin Privatbank. „Ich denke die US-Regierung erkennt zunehmend, dass es für sie sehr teuer werden kann, wenn sie Vertrauen am Anleihemarkt verspielt.“
Kein Grund zur Besorgnis
Für Anlegerinnen und Anleger besteht aber nach Einschätzung von Dobbert kein Grund zur Besorgnis. „Das Ausmaß der Kursschwankungen ist nicht sonderlich außergewöhnlich.“ Zwar ist die US-Schuldenlast der USA in der Tat immens. 2024 lag sie bei rund 36 Billionen US-Dollar. Im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt waren das 124 Prozent. „Das ist aber kein neues Thema. Und bislang hat die Schuldenlast dem Ruf der US-Staatsanleihen als sicherer Hafen nie wirklich geschadet.“
Auch die jüngste Herabstufung des Bonitäts-Ratings durch Moodys im Mai kam nicht sonderlich überraschend. Die Rating-Agentur S&P hatte diesen Schritt bereits 2011vollzogen. Die Rating-Agentur Fitch hatte 2023 nachgezogen. Bei allen drei großen Rating-Agenturen verfügen die USA weiterhin über sehr gute Bonitätsnoten. Trotz der Herabstufung ließ Moodys zudem keinen Zweifel daran aufkommen, dass die USA die Schulden bedienen können. In der Begründung verwies Moodys auf die einzigartige Stellung der US-Wirtschaft unter den bewerteten Ländern. Und darauf, dass die Wirtschaft zwar kurzfristig unter neuen Zöllen leiden könnte, ihr langfristiges Wachstum davon aber nicht wesentlich betroffen sein dürfte.
Weltleitwährung – mit großem Abstand
Die Bedeutung von US-Treasuries für das Weltfinanzsystem ist hoch. „Der US-Anleihemarkt dominiert mit seiner Größe international zwar nicht so stark wie der US-Aktienmarkt“, erklärt Dobbert. „Doch US-Anleihen haben eine immense Relevanz, zum Beispiel weil sie von vielen Notenbanken als eine Art verzinste Währungsreserve gehalten werden.“
Und die Rolle des US-Dollar als Weltleitwährung ist derzeit ebenfalls nicht in Gefahr. Dazu ist die Bedeutung der US-Währung zu groß, wie Zahlen des Internationalen Währungsfonds zeigen. Im Jahr 2024 lag der Anteil des US-Dollars an den gesamten Devisenreserven weltweit bei rund 60 Prozent. Auf Platz 2 lag der Euro mit einem Anteil von 20 Prozent.
US-Bonds im globalen ETF-Portfolio von quirion
Eine Rolle spielen US-Bonds auch auf der Anleiheseite des globalen ETF-Portfolios von quirion – allerdings eine untergeordnete. Dort dominieren Euro-Anleihen mit weitem Abstand, denn Währungsschwankungen würden das konservativere Rendite-Risiko-Profil der Anleihen verzerren. Daher kommen US-Staatsanleihen, wenn dann währungsgesichert zum Einsatz, und zwar in der stabilisierenden Variante der zwei Anleihebausteine des globalen Portfolios. In diesem hatten sie Ende Mai ein Gewicht von 8,2 Prozent. „Bei größeren globalen Krisen wie während der Corona-Pandemie sind die Kurse von US-Staatsanleihen gestiegen, während die Aktienkurse sanken“, stellt Dobbert fest. Sie seien also ihrer Rolle als Risikopuffer gerecht geworden. „Aktuell sehe ich keine Anzeichen dafür, dass sie diese Funktion in Zukunft nicht mehr erfüllen.“
Mehr über unsere Anlagestrategie erfährst du hier.
.avif)
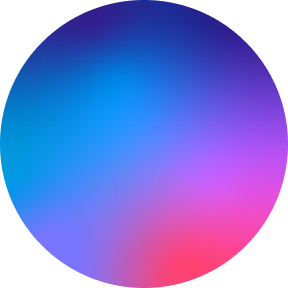






.svg)
.svg)